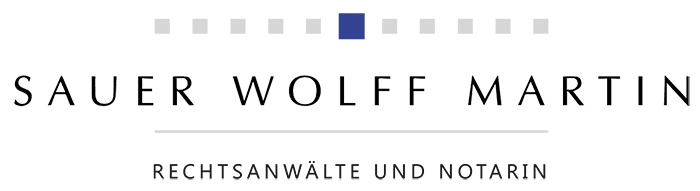Entschädigungsrecht:
Diskriminierung wegen Schwangerschaft
Wird unter Verstoß gegen das Mutterschutzgesetz einer schwangeren Arbeitnehmerin eine Kündigung erklärt, stellt dies eine Benachteiligung wegen des Geschlechts dar und kann einen Anspruch auf Entschädigung auslösen.
Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Arbeitnehmerin, die sich aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert sah. Im Kleinbetrieb ihrer Arbeitgeberin galt zwar nicht das Kündigungsschutzgesetz. Für die schwangere Klägerin bestand jedoch der besondere Kündigungsschutz des Mutterschutzgesetzes (MuSchG). Anfang Juli 2011 wurde aus medizinischen Gründen zudem ein Beschäftigungsverbot nach dem MuSchG für die Klägerin ausgesprochen. Dem Ansinnen der Arbeitgeberin, dieses Beschäftigungsverbot nicht zu beachten, widersetzte sich die Klägerin. Am 14. Juli 2011 wurde festgestellt, dass ihre Leibesfrucht abgestorben war. Für den damit notwendig gewordenen Eingriff wurde die Klägerin auf den 15. Juli 2011 ins Krankenhaus einbestellt. Sie unterrichtete die Arbeitgeberin von dieser Entwicklung noch am 14. Juli 2011 und fügte hinzu, dass sie nach der Genesung einem Beschäftigungsverbot nicht mehr unterliegen werde. Die Beklagte sprach umgehend eine fristgemäße Kündigung aus und warf diese noch am 14. Juli in den Briefkasten der Klägerin.
Die Richter am BAG bestätigten die Vorinstanz, die der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 3.000 EUR zugesprochen hatte. Die Klägerin sei wegen ihrer Schwangerschaft von der Arbeitgeberin ungünstiger behandelt und daher wegen ihres Geschlechts benachteiligt worden. Dies ergebe sich schon aus dem Verstoß der Arbeitgeberin gegen das Mutterschutzgesetz. Da Mutter und totes Kind noch nicht getrennt waren, bestand noch die Schwangerschaft im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung. Auch der Versuch, die Klägerin zum Ignorieren des Beschäftigungsverbots zu bewegen und der Ausspruch der Kündigung noch vor der künstlich einzuleitenden Fehlgeburt weist die ungünstigere Behandlung der Klägerin wegen ihrer Schwangerschaft nach. Der besondere gesetzliche Schutz der schwangeren Frau vor Benachteiligungen führe jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden auch zu einem Entschädigungsanspruch nach dem AGG (BAG, 8 AZR 838/12).
Kündigungsrecht:
Streit um Lohnansprüche berechtigt nicht zur Arbeitsverweigerung
Wer sich beharrlich weigert, seine Arbeit auszuführen, weil er denkt, er sei nicht ausreichend vergütet, riskiert eine fristlose Kündigung. Ein Irrtum schützt ihn nicht.
Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein im Fall eines Arbeitnehmers deutlich gemacht, der seit einem Jahr bei seinem Arbeitgeber als Bodenleger beschäftigt war. Für bestimmte Bodenverlegearbeiten war ein Akkordsatz vereinbart, ansonsten ein Stundenlohn von 12 EUR. Der Arbeitnehmer sollte in 40 nahezu identischen Häusern im Akkord Bodenbelag verlegen. Dabei musste er vorbereitend – wie üblich – auch den Belag in die einzelnen Häuser transportieren, den Untergrund reinigen sowie den Belag zu- und Dämmstreifen abschneiden. Nach zwei Tagen Arbeit rechnete er sich seinen Durchschnittsstundenlohn aus und kam auf einen Betrag von 7,86 Euro brutto. Daraufhin forderte er vom Geschäftsführer einen adäquaten Stundenlohn für diese Baustellen oder aber einen anderen Einsatzort. Dieser lehnte beides ab und forderte den Arbeitnehmer in mehreren Gesprächen eindringlich auf, die zugewiesene Arbeit auszuführen. Zuletzt drohte er ihm die fristlose Kündigung an. Der Arbeitnehmer hielt an seiner Verweigerungshaltung fest. Das Arbeitsverhältnis wurde daraufhin fristlos gekündigt.
Das LAG bestätigte diese Kündigung. Der Arbeitnehmer habe die Arbeit nicht verweigern dürften, weil zu Bodenverlegearbeiten unstreitig Zusammenhangsarbeiten gehörten. Daran änderte auch eine möglicherweise unzureichende Vergütungsabrede nichts. Es galt die getroffene Vereinbarung. Der Arbeitnehmer musste daher erst einmal die zugewiesene Arbeit verrichten und durfte sie nicht zurückhalten. Den Vergütungsstreit musste er ggf. später nach Erhalt der Abrechnung führen. Dass sich der Arbeitnehmer insoweit über ein Zurückbehaltungsrecht geirrt hat, war unbeachtlich. Das Irrtumsrisiko trage der Arbeitnehmer. Wegen der Beharrlichkeit der Weigerung war hier die fristlose Kündigung gerechtfertigt (LAG Schleswig-Holstein, 5 Sa 111/13).
AGG:
Altersgrenzen in Arbeitsverträgen sind keine Diskriminierung
Arbeitnehmer sind durch geregelte Altersgrenzen regelmäßig durch gesetzliche Rentenansprüche materiell abgesichert. Arbeits- und tarifvertragliche Altersgrenzen verstoßen damit nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
So entschied es das Arbeitsgericht Bonn im Fall eines 66-jährigen Rundfunkjournalisten. Er war seit über 30 Jahren als freier Mitarbeiter für eine Rundfunkanstalt tätig. Ende 2012 teilte der Sender ihm das Ende der bisherigen Zusammenarbeit wegen Erreichens der gesetzlichen Rentenaltersgrenze mit. Darin sah der Journalist eine Altersdiskriminierung und klagte gegen den Sender auf Zahlung einer Entschädigung von mindestens 25.000 EUR.
Das Arbeitsgericht wies die Klage jedoch ab. Arbeits- und tarifvertragliche Altersgrenzen, die an das Erreichen der gesetzlichen Altersgrenzen anknüpfen, sind nach dem AGG zulässig. Grund: Die Arbeitnehmer sind dann regelmäßig durch gesetzliche Rentenansprüche materiell abgesichert (Arbeitsgericht Bonn, 3 Ca 685/13).
Witwengeld:
Keine Versorgungsehe trotz kurzer Ehezeit
Der Witwe eines mit nur 51 Jahren an Krebs verstorbenen Polizeibeamten, den sie rund fünf Monate vor seinem Tod geheiratet hatte, steht ein Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung (Witwengeld) zu, weil es sich trotz der kurzen Ehezeit nicht um eine „Versorgungsehe“ gehandelt hat.
Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz im Fall einer Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes lehnte das beklagte Land ihren Antrag auf Witwenversorgung mit der Begründung ab, hier habe eine sogenannte Versorgungsehe vorgelegen. Nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben muss die Ehe mit einem verstorbenen Beamten mindestens ein Jahr bestanden haben, um einen Versorgungsanspruch des überlebenden Ehepartners auszulösen. Das gilt allerdings nicht, wenn nach den besonderen Umständen des Falles angenommen werden kann, dass es nicht der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, dem überlebenden Ehepartner eine Versorgung zu verschaffen. Diese – gesetzlich so formulierte – Ausnahme machte die Klägerin für sich geltend. Das Verwaltungsgericht folgte dem nicht und wies ihre Klage ab.
Das OVG gab ihr hingegen im Berufungsverfahren statt. Die gesetzliche Vermutung, wonach eine Ehe, die weniger als ein Jahr gedauert habe, als eine „Versorgungsehe“ anzusehen sei, habe die Klägerin widerlegt. Zwar greife diese Vermutung regelmäßig, wenn die Heirat – wie hier – in Kenntnis einer schweren Erkrankung sowie der deshalb eingeschränkten Lebenserwartung eines Ehepartners geschlossen werde. Die Klägerin habe aber glaubhaft geschildert, dass der Heiratsentschluss bereits vor Bekanntwerden der lebensbedrohlichen Erkrankung gefasst worden sei. Ihre Angaben seien nach einer vom Gericht durchgeführten Beweisaufnahme auch von mehreren Zeugen bestätigt worden. Der Umstand, dass die Hochzeit nur wenige Tage nach der Diagnose eines bösartigen Hirntumors stattgefunden habe, spreche demgegenüber nicht entscheidend für die Annahme einer „Versorgungsehe“. Hierzu habe die Klägerin ebenfalls nachvollziehbar erklärt, ihr Ehemann habe befürchtet, nach der Chemotherapie und den damit verbundenen Begleiterscheinungen nicht die Kraft für eine Hochzeitsfeier zu haben (OVG Rheinland-Pfalz, 2 A 11261/12.OVG).